PluS-Initiative: Technologie-Bewertung für den Luftverkehr der Zukunft
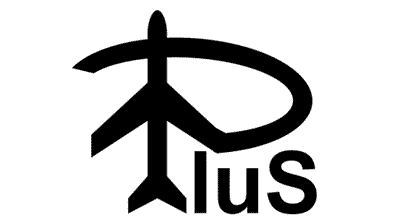
Die Luftfahrt der Zukunft soll effizienter, nachhaltiger und innovativer werden. Dabei steht insbesondere die Halbierung des Energiebedarfs von Flugzeugen bis zum Jahr 2050 im Mittelpunkt. Die Aerodynamik, der Leichtbau sowie die Auslegung einer effizienten Systemarchitektur sind wichtige Faktoren, um dieses Ziel zu erreichen.
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) setzt seit Anfang des Jahres 2025 mit der PluS-Initiative einen neuen Standard für die Entwicklung von Systemen für klimaverträgliches Fliegen. Mit PluS (Plattformunabhängiges Systemmodell) startet das DLR eine Initiative für die Luftfahrtindustrie. Mit ihrer Hilfe sollen Flugzeugsysteme und ihre Energieflüsse und Funktionen in vollständiger Interaktion zueinander in einer Systemarchitektur auf Gesamtflugzeugebene aufgebaut, analysiert und bewertet werden.
DLR als Architekt der klimaverträglichen wettbewerbsfähigen Luftfahrt
Forschende aus mehr als 40 Instituten und Einrichtungen arbeiten im DLR in interdisziplinären Teams daran, hochintegrierte Technologielösungen, Methoden und Prozesse für die Luftfahrt der Zukunft zu entwickeln. Dabei entstehen in Kooperation mit Industrie und Wirtschaft seit mehr als 30 Jahren Projekte und Konzepte für das Gesamtsystem Flugzeug und Luftfahrt. Die innovativen Forschungsprojekte erstrecken sich über die Bereiche emissionsarme Luftfahrtantriebe, Triebwerkstechnologien, baugruppenübergreifender Systemleichtbau, neue Flugzeugkonzepte und Komponenten bis zur Erforschung von klimawirkungsoptimierten Flugrouten.
Mit seinen multidisziplinären instituts-, projekt-, und programmübergreifenden Fähigkeiten ist das DLR in einer herausragenden Position, um weltweit Forschenden aus Industrie und Wirtschaft mit der PluS-Initiative eine Bewertungsumgebung in einem plattformunabhängigen Systemmodell anzubieten.
Technologische Bewertungsfähigkeit instituts-, projekt- und programmübergreifend
Traditionell konzentrieren sich Forschende bei der Flugzeugentwicklung zunächst auf aerodynamische Formgebung und mechanische Strukturen. Erst später im Entwicklungsprozess werden Fragen zur Systemarchitektur behandelt, wie das Zusammenspiel von Energieträgern, Teilsystemen und deren Wirkungen zueinander aber auch in der Bewertung des gesamten Energievebrauchs . Diese sequenzielle Vorgehensweise kann dazu führen, dass nicht alle Potenziale innovativer Technologien voll ausgeschöpft werden.
Hier setzt die PluS-Initiative an: Sie entwickelt ein plattformunabhängiges Systemmodell, das von Beginn an eine integrierte Betrachtung aller relevanten technischen Teilsysteme ermöglicht. Mit digitalen Entwurfswerkzeugen sollen so beispielsweise Entwicklerinnen und Entwickler frühzeitig verschiedene Technologien hinsichtlich Effizienz, Energieverbrauch und weiterer technologischer Bewertungspunkte bewerten können.
Dies erlaubt es DLR-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen mit Entwicklerinnen und Entwicklern aus Industrieunternehmen, ihre Technologien auf einer gemeinsamen Plattform gemeinsam zu analysieren und weiterzuentwickeln. Ziel ist es, die Bewertung neuer Systeme für unterschiedliche Flugzeugkonfigurationen und Mobilitätsszenarien zu ermöglichen.
Besonders relevant ist dabei die Betrachtung von Faktoren wie:
- Energieeffizienz und Funktionalität,
- Integration neuer Energieträger und Antriebssysteme,
- Optimierung des Gesamtsystems in Bezug auf Masse, Volumen und Performance.
PluS-Initiative für die nachhaltige Transformation der Luftfahrt
Durch den gezielten Einsatz digitaler Werkzeuge und Software-Frameworks wie CPACS (Common Parametric Aircraft Configuration Schema) und RCE (Remote Component Environment) baut das DLR eine umfassende Bewertungsumgebung auf. Die Zusammenarbeit verschiedener Institute und Fachbereiche sorgt dafür, dass neue Technologien nicht isoliert betrachtet, sondern ganzheitlich auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden können.
Die PluS-Initiative ist ein essenzieller Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Luftfahrt. Sie schafft eine Basis, um künftige Flugzeuge noch umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und leistungsfähiger zu gestalten. Die enge Kooperation mit Industrie und Wissenschaft trägt dazu bei, die technologischen Innovationen effizient in die Praxis zu überführen und den Wandel zu einer klimagerechten wettbewerbsfähigen Luftfahrt aktiv zu beschleunigen.
